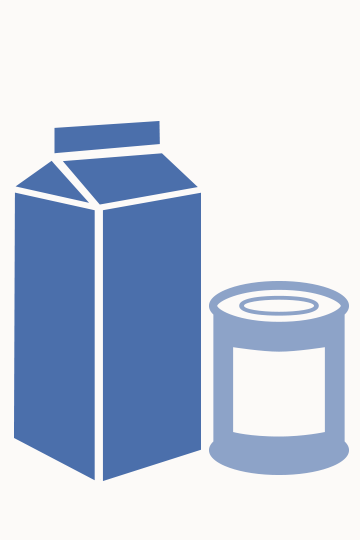Fajitas mit Flusskrebsen
-
700 g
Maistortilla
-
400 g
Flusskrebsfleisch, TK
-
400 ml
Ajvar Paprikamark
-
50,0 g
Chilischoten in Sauce
-
10,0 g
geschälter Knoblauch
-
150 g
Corona Bohnen
-
300 g
Sour Cream
-
20,0 g
Koriander
-
50,0 g
Limetten
-
150 g
Rucola
Maistortillas laut Grundrezept herstellen. Flusskrebsfleisch mit Ajvar, Chipotle und fein gehacktem Knoblauch zu einem Cocktail vermengen. Weiße Bohnen, Sour Cream, Korianderblätter, Limetten und Rucolablätter bereitstellen.