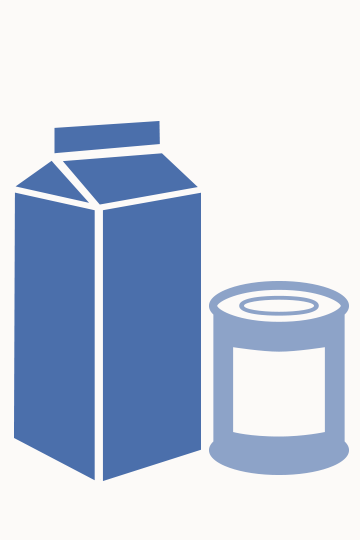Ziegenkäse-Trüffelcreme
-
375 g
Ziegenfrischkäse
-
25,0 g
Tartufo Trüffelsalsa
-
1,0 g
Meersalzkristalle
Ziegenfrischkäse und Trüffelsalsa glattrühren und mit Salz abschmecken.
Croissant und Garnitur
-
900 g
Butter Croissant
-
50,0 g
Butter
-
350 g
Banchetto Italienischer Prosciutto
-
10,0 g
Basil-Kresse
Butter-Croissants nach Backanleitung aufbacken. Diese zwischen 2 Bleche setzen und leicht beschweren.
Die Croissants anschließend in einer heißen Pfanne von beiden Seiten goldbraun anbraten und die Butter nach und nach zugeben.
Die heißen Croissants, Parmaschinken, Basilikumkresse und die bereits vorbereitete Ziegenkäse-Trüffelcreme zum Anrichten bereitstellen.